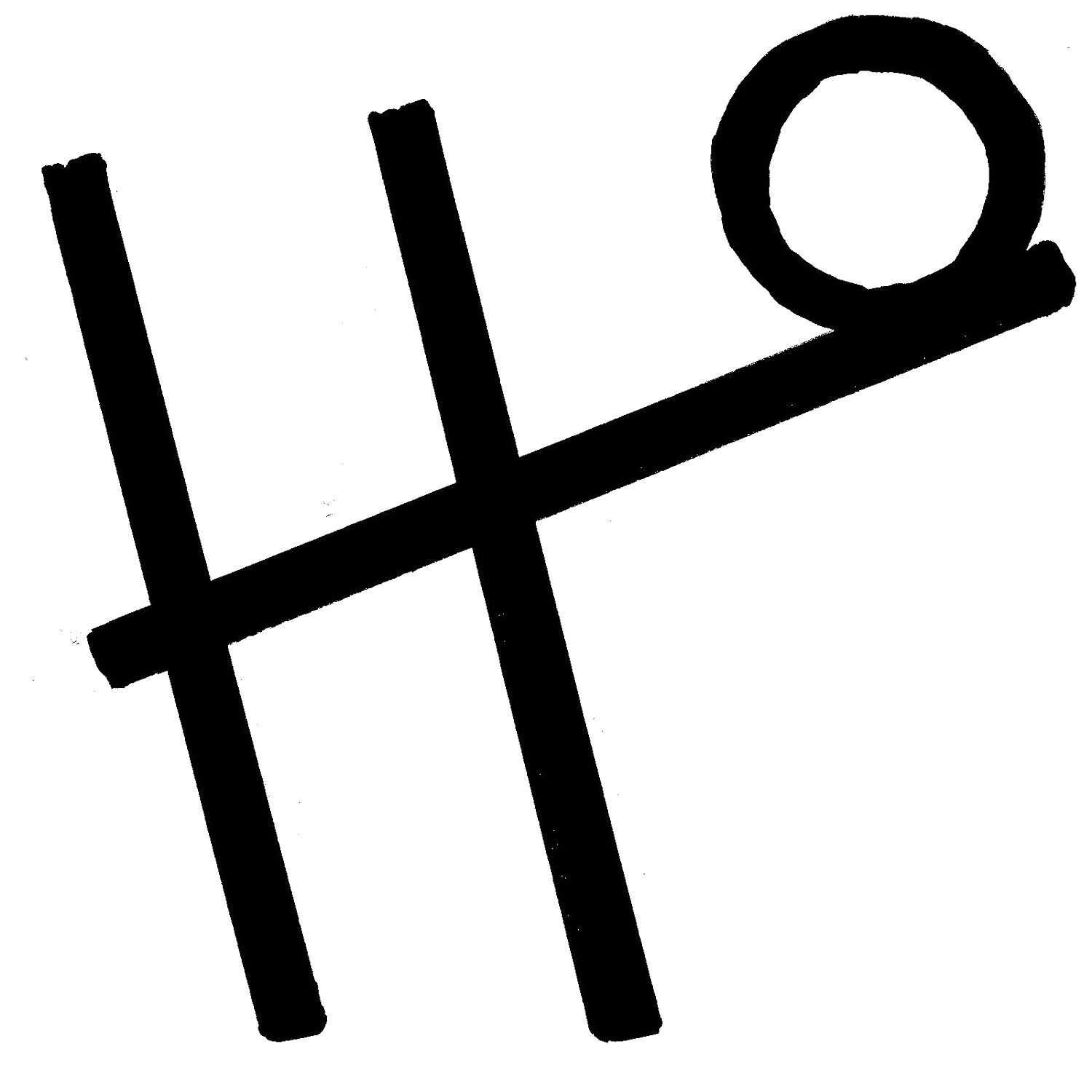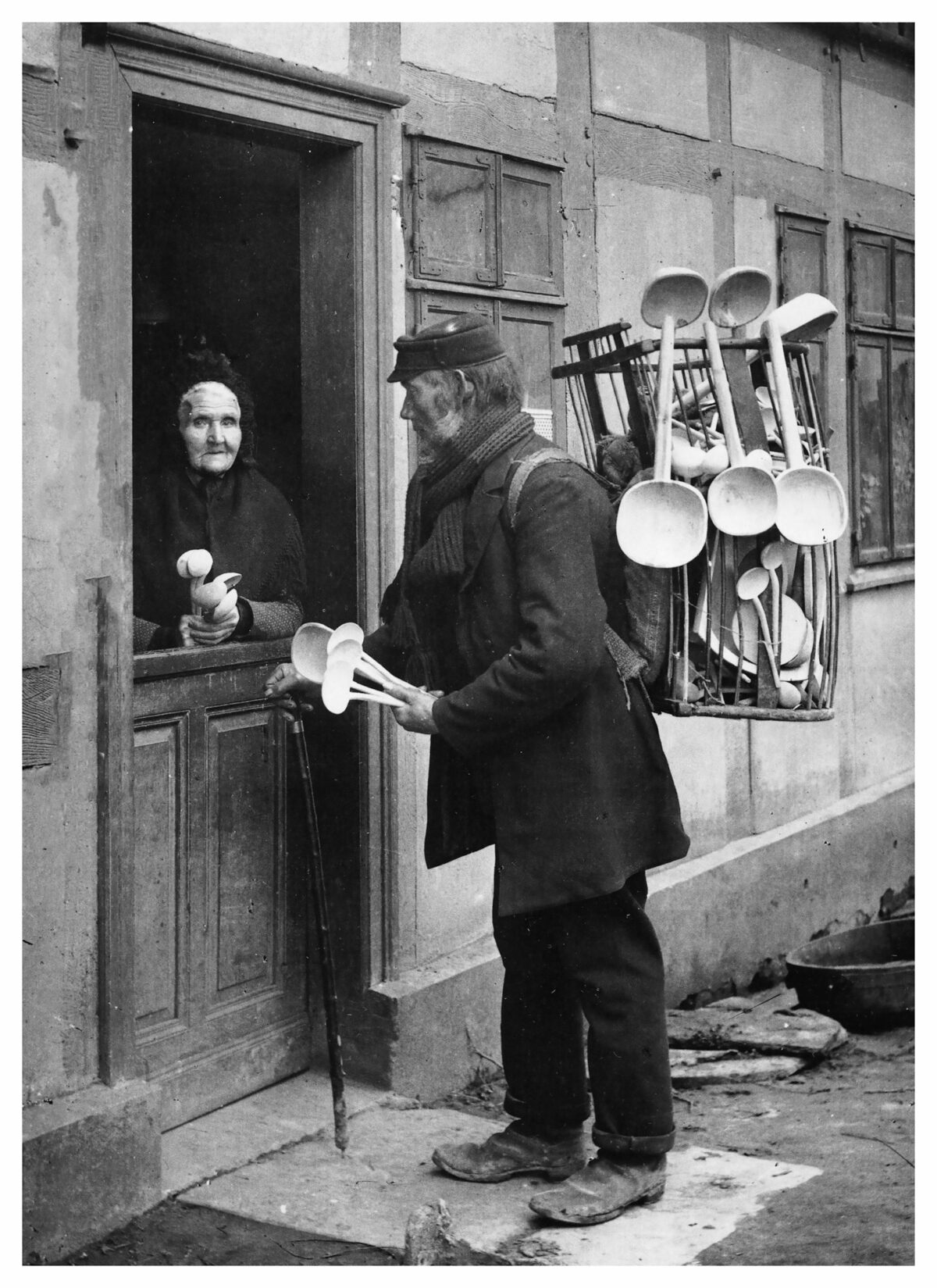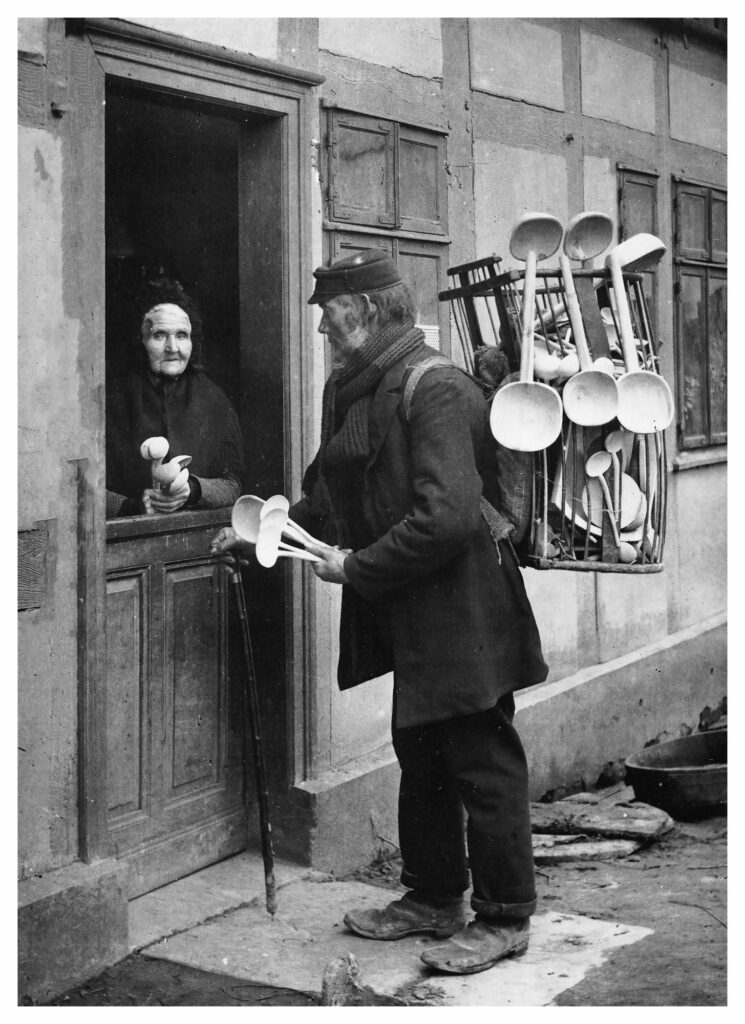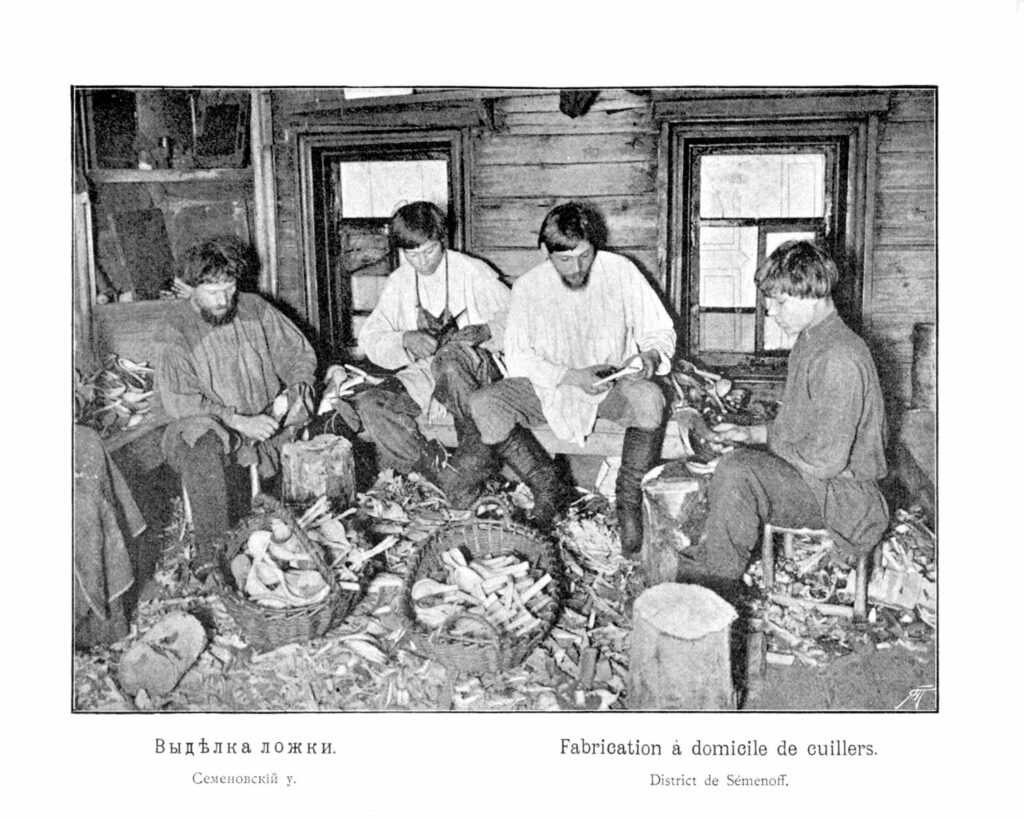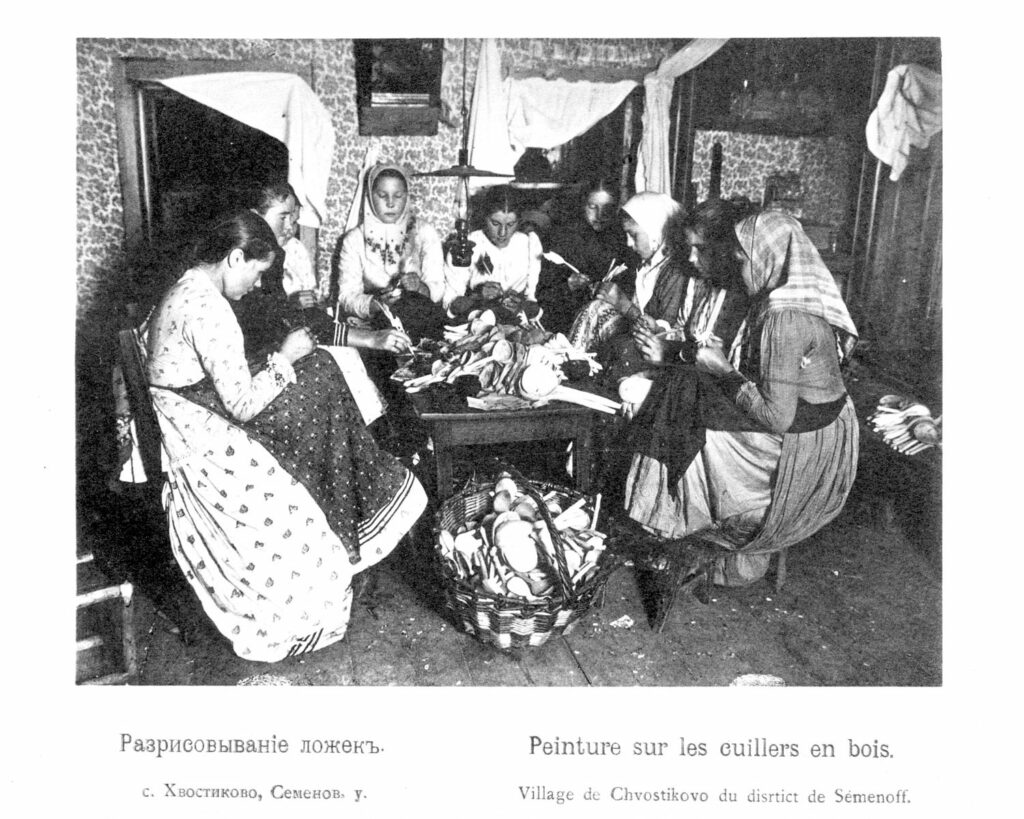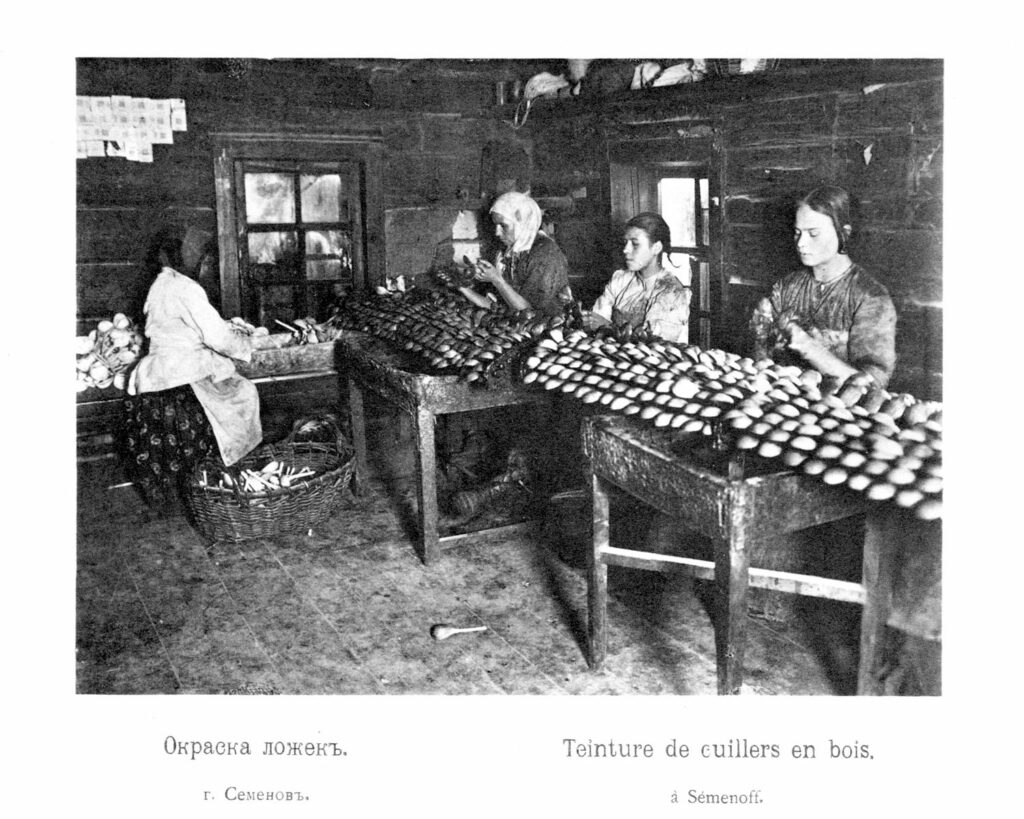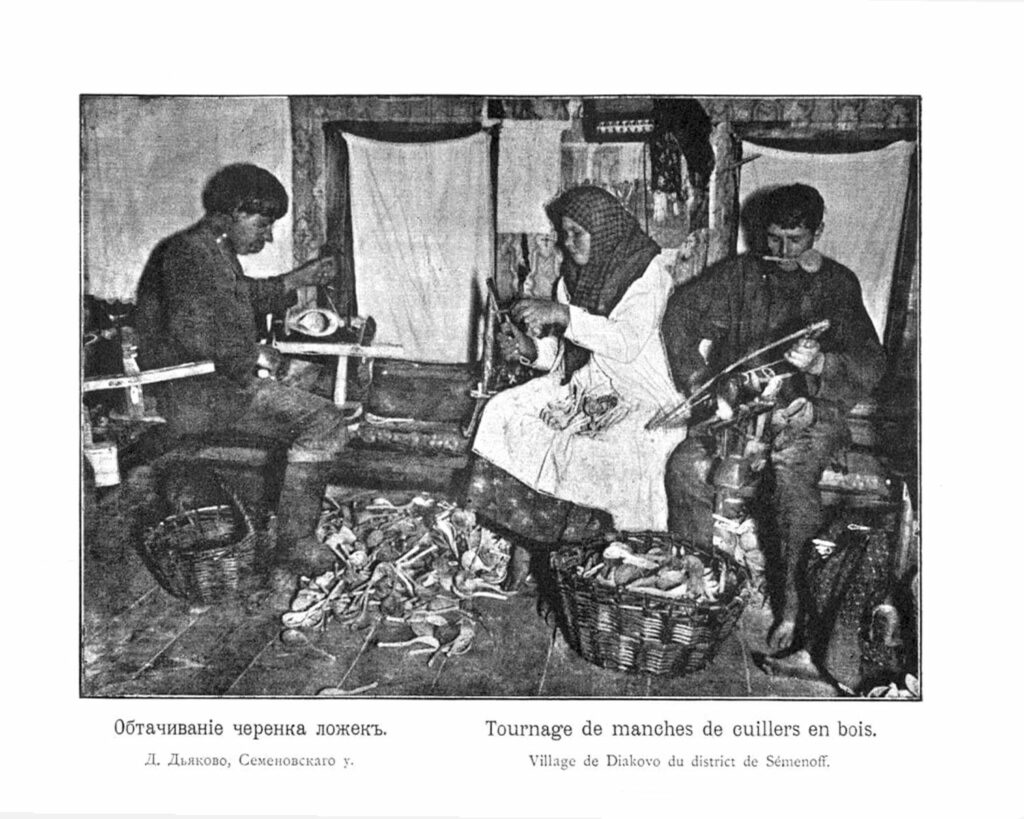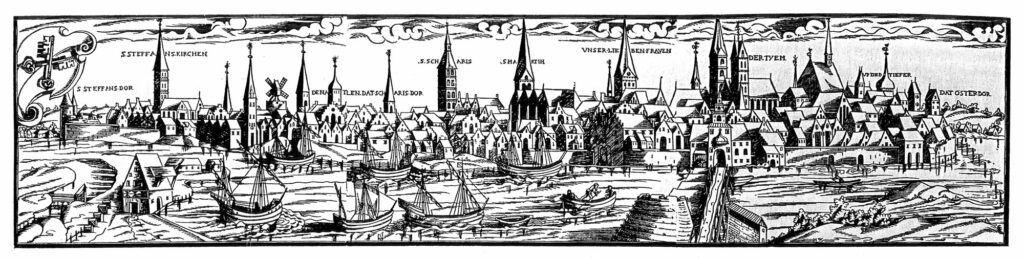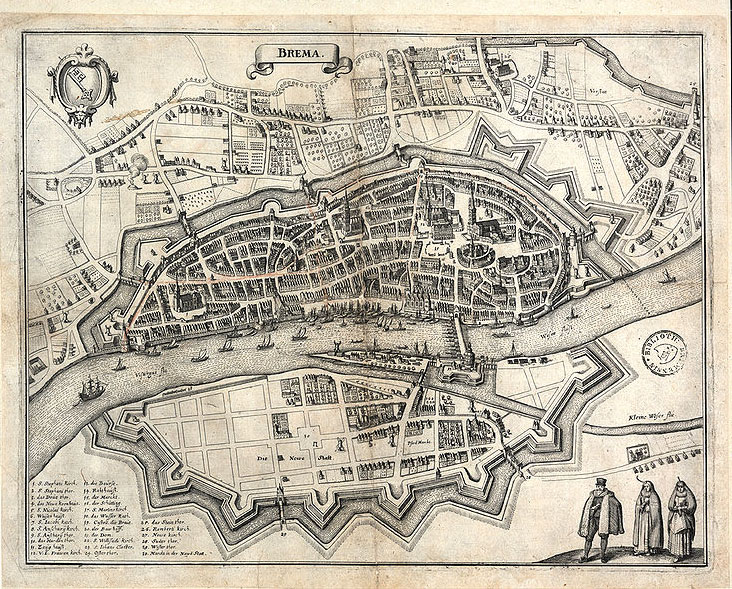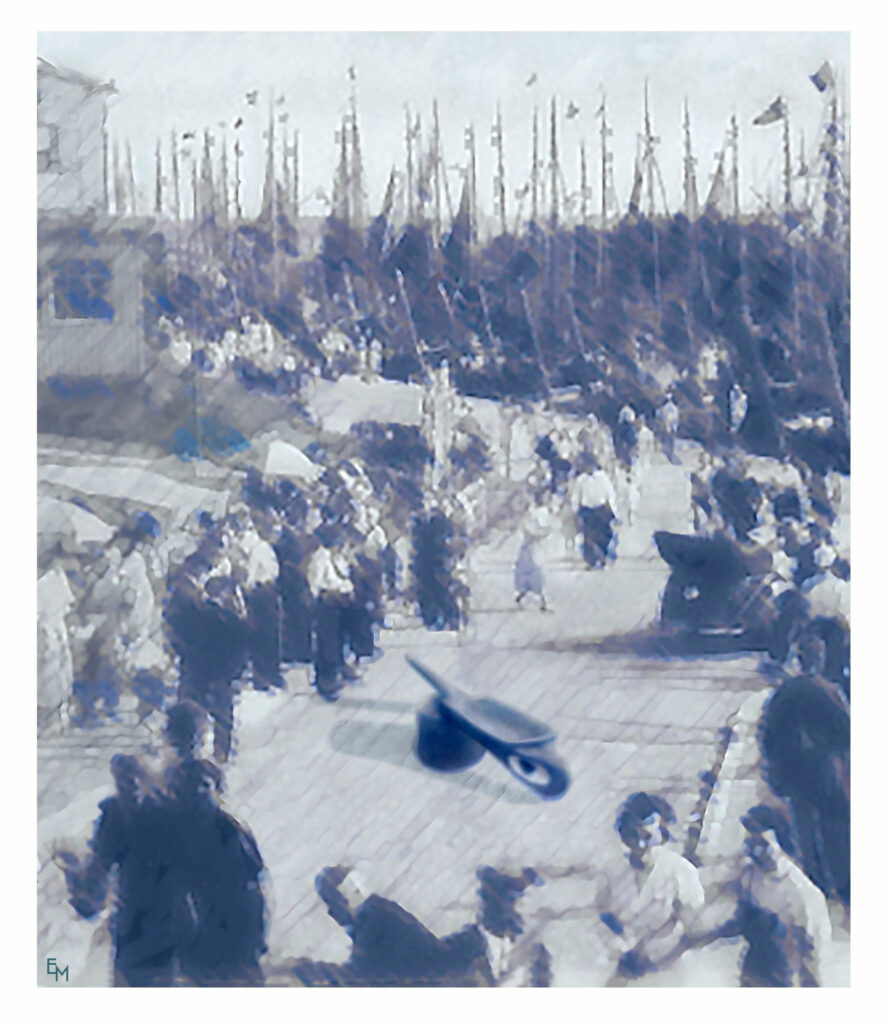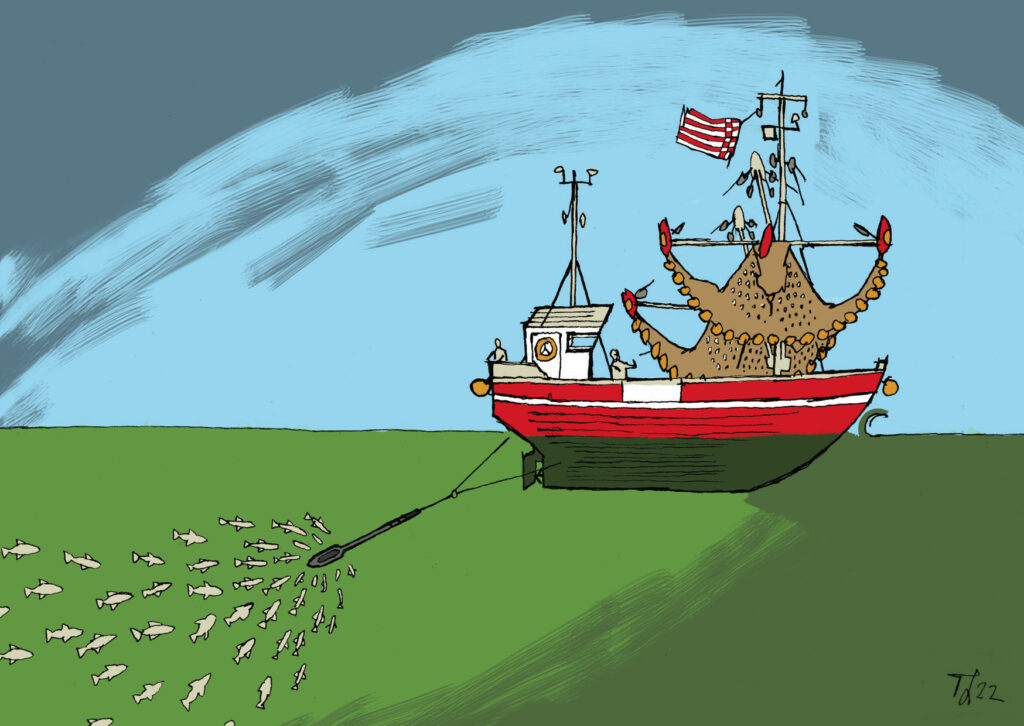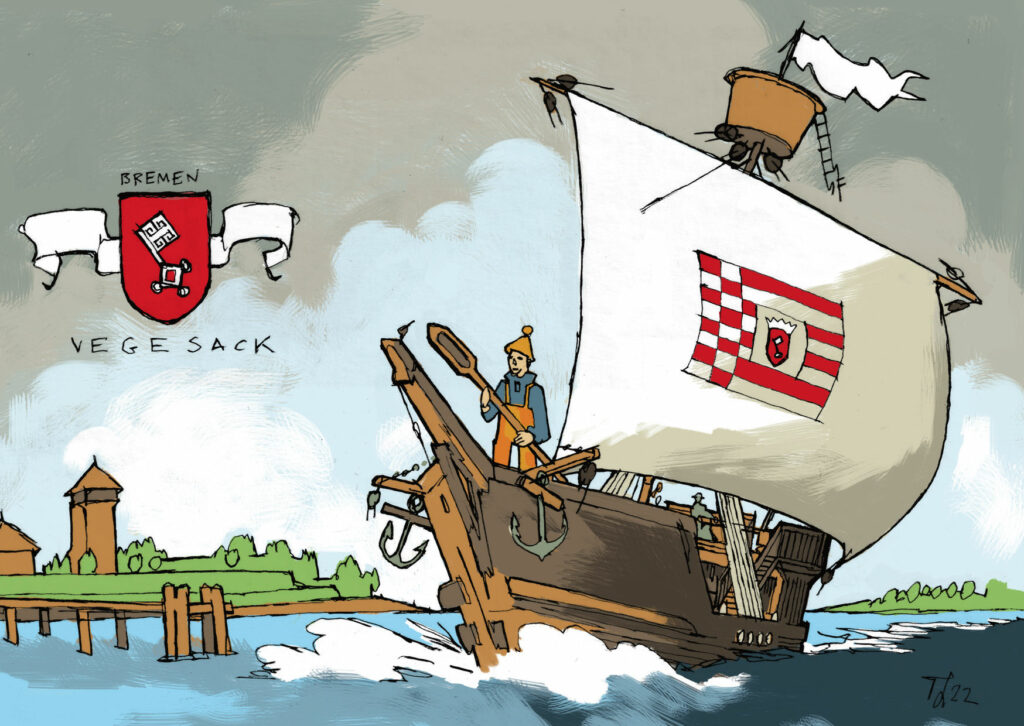Löffel und Justiz
Beim Psychiater
Kommt ein Mann zum befreundeten Psychiater: „Wie kommt man eigentlich in Deine Psychiatrie?“ Der Psychiater: „Wir füllen eine Badewanne und legen einen Löffel, eine Tasse und einen Eimer daneben. Dann sagen wir: Leere die Badewanne!“
Der Mann: „Ah verstehe. Ein normaler Mensch würde den Eimer nehmen.“
Der Psychiater: „Nein, ein Normaler würde den Stöpsel ziehen. Möchtest Du Dein Zimmer mit Balkon?“
Aus Max und Moritz hier: Die Witwe Bolte machte den Spitz für den Abgang der gebratenen Hühner verantwortlich:
Mit dem Löffel, groß und schwer, geht es über Spitzens her;
Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei.
Martin Luther und sein Reiselöffel
Weil sich Martin Luther vor einem Giftanschlag fürchtete, nahm er auf Reisen immer seinen ausklappbaren, eigenen Silberlöffel mit. Der Löffel weist auf Stiel und Laffe folgende Inschrift auf:
„Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Messias wird ausgerottet werden. Christus ist unser Heil. Gottes Wort ist unser Leben. Licht, Friede, Gesundheit und Heil. Das himmlische Brot schützt uns und überwindet die Hölle. Mit höchster Weisheit befreit er die Söhne Gottes. Ist Gott mit uns, wer könnte wider uns sein.“
In der Laffe befindet sich neben einer Kreuzigungsszene ein helles Plättchen Horn eingearbeitet -angeblich von der Elchklaue als Ersatz für Horn von einem Einhorn. Dieses Plättchen – so die damals weit verbreitete Vermutung- sollte sich bei Kontakt mit Gift verfärben. Damit sollte den besonderen Gefahren auf Reisen durch Vergiftung entgegengewirkt werden.
Die Löffelprobe
Ein archaisches Relikt aus den Zeiten des Chamurabi habe ich im Irak entdeckt: Die streitenden Parteien erscheinen vor dem Richter; es steht Aussage gegen Aussage, sodass der Richter allein daraus nicht die Richtigkeit der einen oder anderen Aussage beurteilen kann. Nun wird ein Metall-Löffel erhitzt und jede Partei muss den heißen Löffel mit der Zunge berühren. Derjenige, dessen Zunge anschließend Blasen aufweist – hat gelogen. Ein Gottesurteil!
Eingeweihte wollten mir das Geheimnis damit erklären, dass der Lügner immer einen trockenen Mund hat. Nach meiner Einschätzung eine eher naive Einschätzung gerade von notorischen Lügnern!
Mit Löffel durch die Mauer
Bildzeitung vom 2. Oktober 2000:
9 Knackis weg! Infrarotkameras, Bewegungsmelder, elektronische Schließanlagen – moderne Technik soll in deutschen Gefängnissen für Sicherheit sorgen. Trotzdem gelang jetzt wieder neun Häftlingen die Flucht. Ganz simpel, mit einem Löffel … Die Justizvollzugsanstalt Wilhelmshaven gestern 4:30 Uhr früh. Aber zwei Gefangene hellwach: In ihrer Zelle kratzen Nelo F.(Rumäne, 23) und Munier R. (26, Jugoslawe) mit dem Löffel Putz und Mörtel aus der Mauer. Dann haben sie die Fugen weggeschabt: Wuchtig rammen sie ein Stuhlbein gegen die Mauersteine – fertig ist das Loch (30 x 30 cm) in den Gang. Der Rumäne zwängt sich durch. In der Wachstube überwältigt er einen Vollzugsbeamten, kettet ihn mit Handschellen an ein Bett. Nimmt ihm die Schlüssel ab und befreit seinen Komplizen. Dann holen sie noch sieben weitere Häftlinge aus ihren Zellen …
Ausbrecherin gefasst - Umsonst gelöffelt
18.03.2010
In den Niederlanden hat sich eine Gefängnisinsassin mit einem Löffel einen Fluchttunnel gegraben. Doch ihre Freiheit währte nicht lange.
Wer heutzutage aus dem Gefängnis türmen will, muss sich etwas einfallen lassen – und Geduld haben, wie der Fall einer Ausbrecherin in den Niederlanden zeigt. Mit einem Löffel hat sich eine 35-Jährige in monatelanger und mühseliger Kleinstarbeit einen Tunnel aus dem Gefängnis gegraben.
Die Flucht wurde möglich, weil die Frau nicht mehr in einer regulären Zelle, sondern in einem Sondergebäude untergebracht war. In dem Haus, direkt an der Gefängnismauer gelegen, werden Langzeitgefangene auf die Entlassung ins Zivilleben vorbereitet.
Die Niederländerin hatte noch knapp 22 Monate einer achtjährigen Gefängnisstrafe abzusitzen, als ihr die Flucht gelang: Die Frau buddelte vom Keller unter der Küche einen schmalen Tunnel zum Gehweg neben der Knastmauer. Einmal in Freiheit stellte sich die Ausbrecherin dann aber weniger geschickt an: Nur vier Wochen nach ihrem spektakulären „Löffel-Coup“ wurde sie von der Polizei gefasst – in einer Wohnung nur eine Stunde von der Haftanstalt entfernt.
Aus den Züricher Novellen: „Der Landvogt zu Greifensee“
Der Landvogt saß einmal in der Woche zu Gericht:
Jetzt erschien ein ganz abgehärmtes Ehepaar, das den Frieden nicht finden konnte, ohne zu wissen warum. Die Quelle des Unglücks lag aber darin, dass Mann und Frau vom ersten Tage an nie miteinander ordentlich gesprochen und sich das Wort gegönnt hatten, und dieses kam wiederum daher, dass es beiden gleichmäßig an jeder äußeren Anmut fehlte, die einem Verweilen auf irgendeinem Versöhnungspunkte gerufen hätte. Der Mann, der ein Schneider war, besaß ein tiefes Gerechtigkeitsgefühl, wie er meinte, und grübelte während des Nähens unaufhörlich über dasselbe nach, während andere Schneider etwa ein Liedchen singen oder einen schnöden Spaß ausdenken; die Frau besorgte ausschließlich das kleine Ackergütchen und nahm sich bei der Arbeit vor, beim nächsten Auftritt nicht nachzugeben, und da sie beide fleißige Leute waren, so fanden sie fast nur während des Essens die zum Zanken nötige Zeit. Aber auch diese konnten sie nicht gehörig ausnutzen, weil sie gleich zu Beginn des Wortwechsels nebeneinander vorbeischossen mit ihren gespritzten Pfeilen und in unbekannte Sumpfgegenden gerieten, wo kein regelrechtes Gefecht mehr möglich war und das Wort in stummer Wut erstickte. Bei dieser Lebensweise schlug ihnen die Nahrung nicht gut an, und sie sahen aus wie Teuerung und Elend, obgleich sie, wie gesagt, nur an Liebenswürdigkeit ganz arm waren, freilich das ärmste Proletariat.
Gestern war der Zorn des Mannes auf das Äußerste gestiegen, so dass er aufsprang und vom Tische weglief. Weil aber das durchlöcherte Tischtuch an einem seiner Westenknöpfe hängenblieb, zog er dasselbe samt der Hafersuppe, der Krautschüssel und den Tellern mit und warf alles auf den Boden. Die Frau nahm dies für eine absichtliche Gewalttat und der Schneider ließ sie, plötzlich von Klugheit erleuchtet, bei diesem Glauben, um sein Ansehen zu stärken und seine Kraft zu zeigen. Die Frau aber wollte dergleichen nicht erdulden und verklagte ihn beim Landvogt.
Als dieser sie nun nacheinander abhörte und ihr trostloses Zänkeln, das gar keinen Kompass noch Steuerruder hatte, wahrnahm, erkannte er die Natur ihres Handelns und verurteilte das Paar zu vier Wochen Gefängnis und zum Gebrauch des Ehelöffels. Auf seinen Wink nahm der Weibel dieses Gerät von der Wand, wo es an einem eisernen Kettlein hing. Es war ein ganz sauber aus Lindenholz geschnitzter Doppellöffel mit zwei Kellen am selben Stiele, doch so beschaffen, dass die eine aufwärts, die andere abwärts gekehrt war.
„Seht,“ sagte der Landvogt, „dieser Löffel ist aus einem Lindenbaume gemacht, dem Baume der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. Denket beim Essen, wenn ihr einander den Löffel reicht (denn einen zweiten bekommt ihr nicht), an eine grüne Linde, die in Blüte steht und auf der die Vögel singen, über welche des Himmels Wolken ziehen und in deren Schatten die Liebenden sitzen, die Richter tagen und der Friede geschlossen wird!“
Das Männlein musste den Löffel tragen, die Frau folgte ihm mit der Schürze an den Augen, und so wandelte das bleiche, magere Pärchen trübselig an den Ort seiner Bestimmung, von wo es nach vier Wochen versöhnt und einig und sogar mit einem zarten Anflug von Wangenrot wieder hervorging.